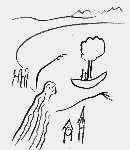x |
|
x |
||
| x | Der Name Zürich | |||
| X |
Begleitheft zum ersten der Zürcher "Wege zur Heimat" 1998
|
X | ||
|
Inhalt |
1. Z der Zauberer > 2. Ü Paar im Segelboot > 3. E betender König > 4. R Flucht vor der Lokomotive > 5. i Blick des Schützen > 6. C Weiter, hoher Himmel > 7. H Der Hafen > Das achte Bild
>
|
X | ||
|
X | |||
Z Der Zauberer |
Der Name
"Zürich" beginnt mit dem letzten Buchstaben des Alphabeths. Das Z ist das
Zeichen des Schwertes. Es schliesst mit einem entschiedenen Schnitt die Möglichkeiten ab,
die uns in der Reihe der Buchstaben gegeben sind. Was nach dieser Grenze kommt, ist
Schweigen. Das Letzte, das Zeichen Z, steht trotzig und zornig da, um dieses Schweigen,
das Geheimnis nach dem noch Aussprechbaren, zu schützen.
Zwingli steht da an dieser Grenze mit dem
Schwert. Er, der Heimat sucht im Wort und dafür auch zu kämpfen wagt, zwingt alle
Buchstaben der Sprache, sich im Zaum zu halten vor dem Schweigen der Ewigkeit. Zwingli
zeigt auf, dass der Himmel, die Ewigkeit, im Menschen selbst ist und nicht im Zepter der
Mächtigen. Und sie zittern, die Mächtigen, vor diesem Prediger, der die Sprache und mit
ihr die Freiheit den Menschen zurückgibt. Zwingli gibt ihnen die Freiheit der Zunge
zurück, ihre eigene Stimme, die sie erheben dürfen und die die Worte Gottes sprechen und
verstehen können. Und er gibt ihnen die Freiheit zurück des Zweifelns, das sich so oft
am Leid der Welt entzündet. Er lehrt sie aber auch die Zurückhaltung vor dem Geheimnis
des Himmels, das in jedem Menschen von seiner Würde zeugt. Indem das Geheimnis des Himmels, das Geheimnis des Unsagbaren, bewahrt
wird, erhält das andere grosse Z, der Zauberer, keine Chance, uns in seinen Bann zu
ziehen. Der Zauberer versucht uns vorzugaukeln, dass alles möglich ist, wenn man nur den
Trick kennt, wenn nur die richtige Technik angewandt wird. Nicht das eigentliche Ziel,
sondern die Anmassung von Aufklärung und Wissenschaft: Alle Geheimnisse aufdecken, alle
Störungen und Leiden aus der Welt verbannen, das Leben in den Griff kriegen. Und der Storch, Sinnbild für
Fruchtbarkeit und Geburt, Sinnbild für das Leben schlechthin, verdreht den Kopf, wenn der
grosse Illusionist mit der Peitsche knallt, als würde er das Leben zähmen wollen. Der
Storch verdreht den Kopf und dreht ihn fort vom trügerischen Funkeln des Zauberstabes. Zürich wurde im Zeichen des Z, als Zollstation, gegründet. An dieser
Stadt kommt man nicht so einfach vorbei. Es wird ihr aber noch heute nachgesagt, sie habe
den Charme und die Gastfreundschaft einer Zollstation. Vielleicht würde es ihr guttun,
nicht nur die Zölle einzuziehen, sondern denen, die zu ihr kommen, die angemessene Ehre
zu zollen: Gastfreundschaft. Freundliche Empfänglichkeit stellt sich ein, wenn man die Zwänge der
Vergangenheit und die Ziele für die Zukunft einmal ruhen lassen kann und dem
"Jetzt" Raum gibt. In diesem Raum des "Jetzt" verbeisst sich der Zahn
der Zeit nicht mehr so tief in die Zwecke der Leistung; eine andere Zeit wird lebendig,
eine Zweisamkeit oder Zwischenzeit. In ihr wird Zoll gezahlt der Sprache und dem
Schweigen, wie Zwingli es einst wollte, als er nach der Freiheit rief. Das "Jetzt" der Gegenwart ist Zollstation am Übergang von
Vergangenheit und Zukunft. In der Zollstation erfrischt man sich und ruht, zahlt aber auch
die Zeche eines Fehlers der Vergangenheit oder verzeiht, was einem das Herz zerbrach. An
der Zollstation der Gegenwart zeigen sich der Zufall und das Plötzliche, welche das
Gesetz von Zahlen und Zählen durchbrechen können.
|
X | ||
|
Ü
Paar im Segelboot |
Der zweite Buchstabe, das "ü", sieht aus wie eine Schale mit zwei Früchten darin oder wie der Schoss einer Mutter und ihre zwei Brüste. Das "ü" nimmt in seiner Schalenform auf, was in es gelegt wird, und bietet es wieder an, schenkt es hin. Wie die Seele annimmt und aufnimmt, was in sie gelegt wird, um es dann wieder zu teilen und mitzuteilen. Das "ü" ist auch ein Schiff mit einem Liebespaar darauf oder ein Liebespaar, das Hand in Hand am Zürichsee spazieren geht. Zürich scheint eine Stadt für Verliebte zu sein. Wer am See oder im Niederdorf spazieren geht, sieht sie, wie sie im Zeichen des "ü" den Überfluss geniessen, den ihnen die Liebe schenkt. Manchmal bis zum Übermut oder sogar bis zur Überforderung, doch im Herzen überglücklich. Das "Z" im Zeichen des Schwertes hat eine Grenze gezogen, doch das "ü" tritt zu ihm hin und ruft ihm zu: "Das hast Du gut gemacht, Du "Z", und nun komme ich und verbinde beide Seiten." Das "ü" ist eine Brücke, die die beiden Punkte, die beiden gegensätzlichen Pole verbindet. Zürich scheint viele Widersprüche zu haben, viele gegensätzliche Ansichten, doch ebensoviele Brücken, welche die zwei Ufer der Limmat verbinden. Die Brücken stehen da wie das "u" in "und". Zürich ist eine Stadt des "und", und als ob die Vernunft sich gegen eine derart dominante Versöhnlichkeit wehren würde, trägt sie oft das "oder" in die Sätze der Zürcher. "Es ist schön heute, oder?" Das Grossmünster ist, mitten in der Altstadt, das grosse "u" von Zürich. Und als wollte es für Zürich ein richtiges "ü" sein, hat es seine spitzen Türme selber angezündet, so dass es angemessene "ü"-Pünktchen erhält mit den zwei neuen, abgerundeten Türmen. Das Grossmünster verbindet Zürich denn auch mit der grossen Welt: durch Karl den Grossen und den Reformator Zwingli. Wind und Geist sind in alten Sprachen oft das gleiche Wort. Der Wind, der Geist der weiten Welt bläst in das kleine Zürich und bläst auch von den Bergen, vom Verborgenen her, um die Herzen weit zu machen. Wäre Zürich ohne diesen Geist eine Provinzstadt geblieben, eng und unversöhnlich gegenüber den Einflüssen von aussen? Das "ü" ist der eigentliche Übergang, die eigentliche Überraschung, welche an der Zollstation, nach dem "Z" also, geschieht. Wenn wir die vielen "ü" sehen in Zürich oder selber eines sind, dann darf es wieder Heimat sein für uns. |
|||
|
E
Der betende König |
Die zwei Punkte über dem "u", die heute den Buchstaben "ü" bilden, wurden ursprünglich als kleines "e" geschrieben, welches im Gefäss des "u" aufgehoben war. Das "e", der Vokal des Lebens, des Gebens und des Nehmens, der Welt, der Weite, des Sehnens und der Wellen auf dem See - dieses kleine "e" ist im umfassenden "u" geborgen. Das kleine "e" sieht aus wie ein Schneckenhaus, dessen Kammern sich von einer geheimnisvollen Mitte aus zur Gegenwart öffnen. Von dorther kommen die Schätze für das Leben, der wahre Reichtum, aber auch das echte Leiden, das uns zur Mitte zurückbringt und sie uns empfinden lässt. Wenn das Leben aber nicht mehr aus der Verbindlichkeit des "u" gelebt wird, wenn sich das "e" vom "u" entfernen will, dann ruft uns die Heimat Zürich verwandelt zu: "zu reich!". Die Heimat macht sich zu, schliesst sich ab. Das sonnige Strahlen des Goldes erblasst zu Geld und verschwindet, mitsamt den Herzen, die an ihm hängen, in den Panzerschränken. Das Leben wird kleinlich und eng; es kugelt sich als kleinliches "e" in sich selber ein und kann sich kaum mehr entfalten. Das grosse "E" hat sich ganz entfaltet, wie ein Schmetterling. Es ist das grosse Leben, das aufrecht, mit einem starken Stamm, Himmel und Erde miteinander verbindet. Das grosse Leben könnte das kleine Leben, welches manchmal kleinlich wird, wieder aufrichten und öffnen, wie eine Blume, die am Morgen von den Strahlen der aufgehenden Sonne berührt wird und sich auftut. Das grosse Leben, das grosse "E", kann das kulturelle Erbe sein, dem wir neu begegnen und das uns neu befruchtet; oder eine eigene Erfahrung, die unser Herz gross und weit macht; oder die Erinnerung an einen guten Freund, den wir besuchen könnten; oder ein Einfall, dem wir Raum geben in unserem Denken und Schaffen. Für den Glaubenden ist Er das grosse Leben, der Erste, der Schöpfer. Für den Buddhisten ist es der Erhabene und für den aufgeklärten Menschen die Einzigartigkeit des Selbst. Immer aber kann das grosse Leben das kleine Leben berühren und es öffnen für die Heimat und die Welt. Dann ist das kleine "e" wieder in sein "u" zurückgekehrt, in das Umfassende und Umgreifende, das ihm Heimat ist und Geborgenheit schenkt. Der Mensch ist als kleines "e" ein König, der sich vor dem grossen "E" verneigt, um von ihm gekrönt zu werden mit der Krone seiner Heimat. Der schönste Ausdruck des Zusammenseins des grossen Lebens mit dem kleinen Leben ist die Ehe. Der Hauch, der Odem des "h", der aus dem grossen Leben in das kleine Leben strömt, ja, fast unhörbar geflüstert wird, erschafft den Bund des Lebens. Von welcher Seite wir das Wort "Ehe" auch lesen, immer ist es eine Ehe. Von der grossen Liebe führt es zum Alltag, von der Freude des Alltags aber auch wieder zurück zur grossen Dankbarkeit. Immer aber steht das grosse "E" vor der Gemeinschaft da. Die Gemeinschaft ist mehr als die Verbindung von zwei kleinen Leben, zwei kleinen "e"; sie wird beschenkt vom Urgrund aller Gemeinschaft, aller Ehe und aller Freundschaft: vom Ewigen. Das Ewige ist das grosse "E" schlechthin und auch die Mitte des kleinen "e", des Schneckenhauses unseres Empfindens und Erlebens. Wenn es aber fehlt, das grosse "E", dann wird die Ehe zu einer Forderung: ehe ich Dir traue, ehe ich mit Dir zusammensein möchte, muss ich zuerst mehr wissen von Dir, musst Du beweisen, dass Du erfüllst, was ich von Dir erwarte. Und immer wieder wird diese Forderung gestellt, wenn das grosse "E" verschwunden ist, bis schliesslich die Ehe daran zerbricht. Die Ehe und die Heimat sind nicht nur für uns da; wir sind auch für die Ehe und die Heimat da, um sie mit unserem offenen Herzen zu erfüllen.
|
|||
|
R
Flucht vor der Lokomotive |
Das "r" gehört zum Rollen, zum Rad und zum Rattern. Es dreht sich rastlos im Kreise, fährt und rast, rumpelt und lärmt, hat einen ständigen Drang zur Bewegung. Die Zeit rinnt uns davon, und wir rennen ihr nach; sie rächt sich, wenn sie verschwendet wird. Die Schwere des Realen drückt auf das Gemüt und macht uns manchmal traurig und manchmal auch getrieben. Der Rummel um die vielen wichtigen und belanglosen Geschäftigkeiten droht uns schwindlig zu machen. Das "e" haben wir im Sein des Lebens gefunden, das "r" finden wir nun im Vorwärtsdrängen des Werdens. Wenn wir ein überdimensionales "r" über Zürich legen, verbindet es seine drei Verkehrsdrehscheiben: Bellevue, Paradeplatz und Bahnhof. Da geht´s rund; wie das Zahnrad einer grossen Maschine hält das "r" dieser drei Umschlagsplätze die ganze Stadt in Bewegung. Das Fliessen des Flusses aus dem See beim Bellevue wird kaum mehr wahrgenommen, so stark sind wir selber zum Fluss geworden, vom Zerren der Masse mitgerissen, sogar am Sonntag, wenn der Spaziergang am See lockt. Das Fliessen des Geldes am Paradeplatz ist ebenfalls gänzlich in den Hintergrund getreten, erkennbar fast nur noch auf dem Papier. Wir sind selber bereits in den Kreislauf des Geldes hineingezogen worden, erkennen uns selber fast nur noch im Fliessen des Geldes. Der Bahnhof aber versorgt die ganze Maschine mit dem benötigten Dampf. Menschenmassen strömen wie Dampfwolken aus den Zügen auf das Perron, vom Perron in die grosse Halle und von dort durch die Ausgänge in die Schläuche der Strassen, wo sie das Geschäft in Bewegung bringen. Oder ist dies schon keine Bewegung mehr, sondern die Rotation der Maschine selber? Zürich reibt sich oftmals auf und rafft und ruft nach mehr. Doch wie das kleine "e" eine grosse Schwester hat, das grosse "E", das sie mit dem grossen Leben und der grossen Welt in Verbindung bringt, so hat das kleine "r" den älteren Bruder "R". Er ist das Recht, die Reue und die Ruhe. Die dynamische, fast rasende Bewegung Zürichs wird durch dieses grosse "R" gemildert und findet in ihm ein Mass, einen Rhythmus, eine Richtung. In Zürich finden wir diese Ruhe, diese ruhigen Orte auch. Sie sind oft versteckt und wollen ungenannt bleiben um der Ruhe willen. Es wird Zürich nachgesagt, dass es ein bisschen bieder und puritanisch ist. Vielleicht ist diese Biederkeit ein zürcherischer Ausdruck für die Gegenwehr, ihre Art, der rollenden Maschinerie und den radikalen Ausbrüchen zu trotzen. Das "r" hält Zürich in Bewegung, achtet darauf, dass es nicht erstarrt. Als Ruhe führt es Zürich wieder heim zu sich, wo es Stadt sein kann und nicht mehr nur Maschine. |
|||
|
i
Der Blick des Schützen |
Das "i": ist es nicht ein Pfeil, der auf ein Ziel hinfliegt? Es zeigt eine zielgerichtete Bewegung, hält aber nach dem Abschiessen des Pfeiles inne, wartend, ob der Pfeil das Ziel denn auch treffe. Das umgedrehte "i" ist ein Ausrufezeichen: ein Ruf oder ein Befehl. Er kommt vom anderen her, von Freund und Feind, vielleicht vom Himmel manchmal auch, und trifft uns hier. Das "i" aber geht aus vom Ich und sucht den anderen an seinem Ort zu finden. Das "ü" bestand noch aus zwei "i", die sich in Liebe die Hand geben, ja gar umarmen und sich küssen. Das "i" ist nun der Einzelne, der alleine steht. Es zieht ihn zum anderen hin, es lebt in ihm eine Sehnsucht, diesen Punkt zu treffen. Der Mensch zielt als "i" auf den Punkt seines Seins im Himmel. Ist dieser Punkt nicht wie ein Nabel im Himmel, vom Rad der Welt die Nabe, um die sich alles dreht, eine verborgene, lebensspendende Mitte? Ist der kleine Strich nicht wie ein Weg, der zu dieser Mitte, zu dieser Heimat strebt? Die Urania-Sternwarte ist ein grosses, dickes "i". Und wie um ihre Plumpheit ein bisschen zu entschuldigen und zu bestätigen, dass sie ein "i" sein möchte, guckt oben durch die Öffnung in Form eines Fernrohres nochmals ein kleiner i-Strich hinaus und zielt auf den kleinen Punkt da oben. Wie abgenabelt ist der Stern vom Auge des Betrachters, wie abgenabelt ist der Mensch überhaupt von diesem Punkt, zu dem er hinstrebt und doch nicht weiss, was er bedeutet. Früher sagte man, dass die Sterne winzige Löcher sind, wie Nadelstiche, die durch das Himmelszelt hindurch das Urlicht scheinen lassen. Dieses Himmelszelt schenkt uns Geborgenheit und Heimat, nicht eine Unendlichkeit des Weltalls, die nur unheimlich ist. Heimat hat etwas mit Endlichkeit zu tun: genau diese vier Wände meiner Wohnstube, in der es mir wohl ist, genau diese Stadt, die mir vertraut ist, genau diese Erde mit diesem Himmel, durch den die Ewigkeit uns liebevoll betrachtet; all dies macht die Wärme und Unauswechselbarkeit, macht das Geheimnis der Heimat aus. In der Stadt, die mir Heimat ist, sind alle Städte da, und im Betrachten anderer Städte erkenne ich durch sie hindurch meine Heimatstadt. In der Person, die ich liebe, sind alle Personen da, und im Betrachten anderer Männer und Frauen erkenne ich durch sie hindurch stets die Person, die ich liebe. Aus diesem Grunde ist die Treue nicht so schwer, wenn Heimat erst gefunden ist. Das ist der i-Punkt. Er ist ganz nah zu uns, ja, er ist in uns drin. Jede Begegnung zielt auf diesen Punkt, denn er umfasst die ganze Welt in ihrem Geheimnis. Wer wirklich sieht, wer klar zu denken vermag, sieht das Innere. Er hört das Äussere, gehorcht auch seinem Mass und seinem Gesetz. Er hört dort, wo das Ohr wie ein Schneckenhaus sich öffnet, die wunderschöne Gestalt der Aphrodite, der Schönheit dieser Welt; doch mit den Pfeilen seines Blickes bleibt er nicht im Aussen stehen, sondern trifft den Punkt des "i". |
|||
|
C
Weiter, hoher Himmel |
Das "c" ist ein seltsamer Buchstabe. Alleine kennen wir ihn nur in Wörtern französischer Herkunft: Cafe creme. In Verbindung aber mit dem h und dem s ergeben sich typische schweizerdeutsche Laute: einerseits das "ch" von Chreis Cheib, Chnelle, Chueche und Chog; andererseits das "sch" von häsch, bisch, tuesch, von Schtütz und Induschtrie - und beides zusammen dann in unserem geliebten Chuchichäschtli. Im "ich" von Zürich sagen wir von unserer Stadt, dass wir eigenständig sind, dass wir manchmal auch ein bisschen Egoisten sind. Nach dem "i" der Sehnsucht geben wir aber auch zu, dass wir zu dieser Schweiz, zu diesem CH gehören, das wir auf unsere Autos kleben. Und vielleicht gar zu Europa. "Chunt nöd in Frag, chasch vergässe, chömmer eus nöd leischte." Und als ob uns die Welt unser eigenes offenes Heimatgefühl zurückbringen wollte, hören wir überall die CH-Laute des Arabischen, die Musik von Chaled, die weichen italienischen c´s in "chiaro" und "chianti" wie auch das feine französische "chocolat chaud" und die Offenheit im Worte "ciel". Der Himmel ist weit, und viele Wünsche haben Platz und viele Engel. Zürich ist eine Weltstadt: Heimat wohl und doch ganz offen. Das "c" ist der Punkt auf dem "i", wie er in Raum und Zeit erscheint, Ort und Heimat lebendig und konkret. Und plötzlich sehen wir, dass dieser Ort der Heimat offen ist als "c" - als "c", das beide Arme streckt zum Gruss. |
|||
|
H
Der Hafen |
Zürich selbst ist ein Weg zur Heimat. Vom "Z" der
Zollstation ist es wirklich zu einem "h" der Heimat geworden. Die Rundbögen am
Limmatquai erzählen von diesem "h", der Kreuzgang im Fraumünster oder die
Bänke, auf denen wir sitzen an der Seepromenade. Das "h" ist ein Hauch des
Ausatmens, des Angekommenseins.
Am Schluss des Names sind wir im Hafen Zürich angekommen wie im Hafen der Ehe, in der die Heimat auch die Mitte ist. Doch weder im Hafen der Ehe noch in Zürich ist die äussere Heimat das Entscheidende. Die Mitte ist im Herzen. Die Mitte ist im Herzen, aber nicht so, dass wir die Mitte in unserem Gefühl oder in unserer subjektiven Befindlichkeit selber machen könnten. Es ist dasselbe wie mit der Hoffnung und dem Heil. Das grosse "H" kommt vom grossen Leben und von der grossen, ruhigen Bewegung her, wie wir es beim grossen "E" und grossen "R" gesehen haben. Das grosse "H" tritt zum kleinen "h" hinzu, nährt es und mehrt es und lässt uns empfinden, dass Hoffnung, Heil und Heimat nicht machbar sind, sondern von der Mitte her uns geschenkt werden, wenn wir sie hinnehmen können. Wir können auch jemandem falsche Hoffnungen machen und ihn dann der Enttäuschung preisgeben. Und schon oft wurde in Zürich mit falschem Heil das Geld verdient. Und Heimat: Heimat wurde schon oft aus falschen Gründen angenommen und aus falschen Gründen abgelehnt. Das grosse "H" steht da wie die beiden Bäume im Paradies: der "Baum des Lebens aus der Mitte" und der "Baum des Werdens aus Wissen und Macht". Doch es ist eigentlich nur ein Baum, der in der Mitte des Paradieses steht. Wir dürfen den Baum von Wissen und Macht nicht trennen vom Baum des Lebens aus der Mitte. Wenn wir dies tun, werden wir aus dem Paradies, aus der Heimat vertrieben. Unser bewusstes Dasein möchte genährt werden aus der lebendigen Mitte. Diese Nahrung schenkt uns Nähe, Urbild aller freien Heimat, gefunden in der Ruhe. In Zürich stehen zwei Bäume, zwischen denen eine Hängematte gespannt ist; darin dürfen wir auch einmal nur sein, nichts tun und Ruhe finden
|
|||

Das achte Bild |
Auf dem achten Bild sehen wir die Wege zur Heimat, gesammelt aus den Bildern zu den sieben Buchstaben des Namens "Zürich". Oben rechts erkennt man die Stadt mit der Quaibrücke und den Kirchtürmen. Zu ihr hin führt wie der weite Schwung des Seeufers ein Weg. War er nicht das Segel, in das der Wind der weiten Welt blies? War er nicht der gebückte Rücken des Königs Mensch? Der Schienenstrang der rollenden Lokomotive? Die Form des denkenden und in diesem Denken das Innere sehende Menschenkopfes? Am Seeufer steht ein Fischer und wirft seine Angel aus. Auf dem vierten Bild ist er noch geflüchtet vor der drohenden Lokomotive. Auf dem fünften Bild war er schon ein Engel, ruhiger Wunsch und Leichtigkeit. Im achten Bild hat er nun zur Gelassenheit gefunden des stillen Anglers. Auf dem Weg zur Heimat wirft er seine Angel aus nach den Schätzen dieser Welt. Dieser Schatz erscheint inmitten des Zürichsees als Aphrodite, im ersten Bild noch von der Illusion des Zauberstabes verdeckt, auf dem zweiten Bild schon zum Wind des Geistes geworden, vom langen Bart des Königs schamvoll verhüllt, vom Ohr der Sehnsucht wahrgenommen, im Baum des Lebens als Einheit gewagt. Aphrodite ist das lebendige Geheimnis der Begegnung mit der Welt, das sich im Äusseren zeigt, doch nur im Herzen sichtbar wird. Schaumgeborene genannt, erscheint sie aus den Nichtigkeiten dieser Welt als Göttin unseres Staunens und Wunderns - nein, noch mehr: als Göttin eines göttlichen Wunsches in der Welt, uns zu begegnen in unserem freien und liebenden Erkennen ihrer ewige Heimat schenkenden Kraft. Alle wahre Geborgenheit und Liebe steht unter dem Schutz des Weges in die Welt, ohne den sie leer, eng und hart würde. Alle wahre Heimat in der Welt muss von dieser Urheimat, von der Aphrodite zeugt, genährt werden. Diese Nahrung ist es, die der Staunende auf dem Weg in die Heimat bringt und sie damit bereichert. In der Heimat aber finden wir den Ort des Glücks, an dessen weicher, warmer Brust wir uns laben dürfen wie ein Kind.
|
|||
| Wege
zur Heimat
Essay von Thomas Primas |
Früher, als die Welt noch gross und heil war und Himmel und Erde in ihr versöhnt, da glaubte man, dass Heimat dort ist, wo man geboren wurde. Das Dorf, die Stadt, das Land, wo die Krippe stand und wo man lebte: das war Heimat. Reiste man in das nächste Tal, den Fluss hinunter oder gar den Strom entlang an noch fernere Orte, fühlte man sich fremd, und daher war Gastfreundschaft ein hohes Gut. Sie tröstete darüber hinweg, von der Heimat getrennt zu sein, und schenkte dem Reisenden eine heimatliche Enklave in der Fremde. Wenn man zurückkehrte, kam man in die Heimat zurück. Nicht nur, dass da jemand wartete auf den Reisenden: die Frau, die Kinder, die Eltern, die Freunde, die Arbeit; er kam auch heim zu sich. Er selber wartete dort auf sich, etwas von ihm blieb stets in der Heimat und wartete auf seine Rückkehr. Weil etwas immer zurückblieb in der Heimat, fühlte man sich fremd in der Fremde und heimisch in der Heimat. Mit der Rückkehr brachte man der Familie und den Freunden Geschenke oder Handelswaren mit aus der Welt. Das Leben der Daheimgebliebenen wurde reicher und erfüllter dadurch, die Welt kam zu ihnen und ihre Schätze. Der Reisende kam aber auch zu sich selber zurück, und er brachte auch sich selber die Weite der Welt mit: Erinnerungen, Eindrücke, Düfte, Bilder. Unaussprechbar waren diese Schätze und nur umrisshaft vermittelbar in Geschichten oder kleinen Gegenständen. Er kam zurück in sein Bergdorf oder in sein mitteleuropäisches Städtchen; wer konnte hier die Nachricht verstehen von grossen Feldern im Tal oder weiten Wüsten in Südspanien? Wie konnten selbst Männer von Welt wie der Papst oder der König die Erzählungen von Marco Polo verstehen? Vielleicht verstand nicht einmal er selber, das heisst derjenige Teil, der immer in der Heimat blieb, diese Mitbringsel des Reisenden aus der Fremde. Der Reisende konnte sein Daheimsein nicht überzeugen, von der Heimat wegzugehen. Immer wieder packte den Reisenden das Fernweh, und es zog ihn ins nächste Tal, den Fluss hinab oder den Strom entlang; das Haus der Heimat blieb aber stets bewohnt, blieb Mitte des Reisenden und zog ihn wieder zurück. Es war die Zeit, als es noch Heimweh gab.
2 Heute ist die Welt klein geworden, rund und handlich, fast wie ein Apfel, den wir vom Baum des Wissens pflücken und in unsere Tasche stecken, um ihn dann später einmal, daheim, zu essen. Klein ist die Welt geworden; von überallher drängen Nachrichten zu uns hin von grossen Feldern und weiten Wüsten, und überallhin drängt es uns zu reisen, um Geschenke und Handelsware zurückzubringen. Aber wohin kehren wir zurück? Ist da jemand, der auf uns wartet? Sind wir selber auch noch da in der Heimat und warten auf unsere eigene Rückkehr? Der Mensch ist nicht mehr Reisender und ist nicht mehr Wartender in der Heimat. Die Grenze zwischen Heimat und Fremde muss nicht mehr überschritten werden, ja, sie ist überhaupt verschwunden. Die Welt ist grenzenlos geworden, damit ohne Mitte und ohne Heimat. Der Reisende hat den sonst immer in der Heimat Bleibenden überzeugen können, mit ihm zu kommen, und so ist das Haus in der Heimat leer. Der Reisende hat seine Unruhe in das Haus der Heimat mitgebracht, und niemand war da, um es aufzunehmen und zu beruhigen. Nun eilt die Unruhe von Zimmer zu Zimmer und wirbelt, achtlos, die Dinge auf und durcheinander, jene Dinge, die einst sorgsam hingestellt wurden, um ihnen Ort und Raum zu geben in der Welt der Heimat. Die ruhige Ordnung der Heimat ist aufgewirbelt und kann nur noch formal, als letztnotwendiges Gerüst, den leeren Raum der Heimat umrisshaft bezeichnen. Die ruhige, ja stille und schweigende Mitte, um die jede Heimat gebaut ist, ist verschlossen. Der Mensch hat sich von ihr entfernt und entfremdet, hat die Türe zu ihrem Raum zugeschlossen und ihr den Rücken zugewandt, weil er ihre verbindliche Einfachheit nicht mehr ertragen konnte. Ohne die Einfachheit der Heimat muss ein kompliziertes Gerüst errichtet werden, um zu verbergen, dass die Mitte verloren gegangen ist. Auf diese Weise ist der Staat zu einem formalen Gebilde geworden, so kompliziert, dass dessen räumliche und rechtliche Grenzen keine Mitte ahnen lassen, aus der man stolz und mutig Welt erbauen könnte. Und auch die Gastfreundschaft trocknet aus und schrumpft zur Formalität, die keine Heimat mehr schenkt, sondern nur noch gemeinsames Unterwegssein bezeugen kann und will. Man isst auswärts heute, und kaum zuhause, will man sich morgen zusammen den Film im Kino ansehen.
3 Wir sind alle unterwegs, und der Wind zerzaust unsere Haare. Der Wind des Unterwegsseins zerzaust die Haare aber so, dass sie nun überall auf der Welt gleich aussehen. Das Unterwegssein ohne Heimat bringt überallhin die gleiche Monotonie; darum fühlen wir uns in der Fremde nicht mehr fremd, fühlen uns aber daheim auch nicht mehr heimisch. Wir gehen nicht mehr auf Reisen in die Welt und kehren nicht mehr zurück zu uns. Der Weg und die Heimat scheinen eins geworden zu sein, doch sie sind nicht eins geworden. Der Weg und die Heimat können nicht eins werden; weder kann die Heimat zum Weg werden, noch der Weg zur Heimat. Sie sind im Wesen verschieden voneinander und grenzen sich, um jeweils sich selbst zu sein, gegeneinander ab. Wenn es uns so scheint, als wären die beiden eins geworden, dann bedeutet dies, dass Weg und Heimat mit ihrer Grenze auch sich selbst, ihren Sinn und ihre Selbstverständlichkeit verloren haben. Weg und Heimat sind grenzenlos geworden und treffen sich - als parallele Linien - nur in einer Unendlichkeit wieder. Doch hier, in der Welt der Endlichkeit, sind sie ohne gemeinsame Grenze berührungs- und beziehungslos und können in diesem Zustand nur bestehen, wenn das jeweils andere vernichtet wird. So hat der Weg die Heimat aus dem Weg geräumt, um ohne Störung durch eine verbindliche Mitte überallhin zu kommen. Das Suchen - die Sehnsucht - hat das Finden - das Fundament - weggeräumt, um weiter träumen und schwärmen zu können, ohne auf das Fundament des Seins und der Existenz gestellt zu werden. Und die Fragen räumen die Antworten weg, um noch verwegener und noch mutiger zu klingen, ohne aber in die Gefahr zu kommen, sich an ein Wort halten zu müssen. Die Heimat, oder was Erstarrtes und Unlebendiges an ihr übriggeblieben ist, hat im Gegenzug den Weg wie einen gefangenen Vogel zu sich heimgenommen und in einen Käfig gesperrt, so dass ihm die Flügel verkümmern und sein Gesang verstummt. Die Heimat hat den Weg unheimlich gemacht, und niemand getraut sich mehr, auf wirkliche Wege zu gehen, im Denken und Tun mutig auch unsichere Wege zu wagen und dann auch wirklich an einem überraschend neuen Ort ankommen zu wollen. In allen grossen Gestalten des wirklichen Seins - Ehe, Freundschaft, Arbeit, Wissenschaft, Kunst, Religion - sind Heimat und Weg verlorengegangen. Ohne die Grenze, die zwischen ihnen steht und die immer wieder überschritten werden muss, um von einem Bereich in den anderen zu kommen, gibt es weder Heimat noch Weg. Das Bewegtsein durch die Sehnsucht, das Interesse und die ehrfürchtige, freudige Neugier, die uns ausziehen lässt in die Weite der Welt, wird zur blossen Unruhe, die nicht still sitzen und aus der Stille das Geheimnis vernehmen kann, aus dem Heimat erwächst. Und die Ruhe des Angekommenseins, des Daheimseins, des freundlich Aufgenommen- und Umgriffenseins, verwandelt sich in blosse Stagnation, Erstarrung, Langeweile. Heimat gibt einem dann das Gefühl, eingeschlossen zu sein; man möchte diese Eingeschlossenheit aufbrechen und zerbricht in diesem Aufbruch ohne Mitte die Heimat selbst.
4 Der Mensch empfindet heute in einem immer stärkeren Masse, dass die Grenzen sich auflösen und zersetzen: die Werte, Gewissheiten, Geborgenheiten, aber auch der andere Sinngehalt der Grenze: Verbindungen, Bündnisse, Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten. Der Mut und die Demut sind verloren gegangen, an diesen Grenzen daheim zu sein und an diesen Grenzen unterwegs zu sein. Ja, der Verlust von Mut und Demut haben erst dazu geführt, dass sich die Grenzen auflösen und zu Humus und Dünger gezüchteter Grenzen werden: Ideologien, Rechthabereien, Unduldsamkeiten in allen Bereichen. Die Grenzen kommen vom Menschen her, von seinem Mut und seiner Demut; aber nicht so, dass er sie selber machen oder setzen könnte. Sie kommen vom Menschen her, aus ihm heraus, aus seiner Mitte, die dem bewussten Denken oder bewussten Konstruieren nicht zugänglich ist. Sie kommen von der menschlichen Mitte her, und diese kann nur in der Stille vernommen werden. Und eigentlich kann die menschliche Mitte nicht in der Stille eines einzelnen Menschen vernommen werden, sondern nur in der gemeinsamen Stille mehrerer Menschen, an verschiedensten Orten und zu verschiedensten Zeiten. Zum Mut des einzelnen Menschen, sich an diese Stille hin zu wagen, muss die Demut kommen, welche weiss, dass niemand das Geheimnis alleine hören kann, weil uns das Geheimnis, als Fundament des Seins, gemeinsam Heimat ist. Jeder Mensch findet seine eigene Grenze in dieser Unmöglichkeit, das Geheimnis alleine zu finden. Diese Grenze will gewahrt sein, und der Mensch kann sie wahren in seiner Demut, sie zu respektieren, und in seinem Mut, sie trotzdem zu überschreiten. Der Schritt von der Demut zum Mut und vom Mut zur Demut ist ein Schritt über eine Grenze, die die beiden unterscheidet. Wenn diese Grenze verschwindet, zerstört der Mut die Demut und umgekehrt - so wie ohne Grenze der Weg die Heimat zerstört und umgekehrt. Auch zwischen den Menschen ist eine Grenze und zwischen den Menschen und dem Geheimnis; sie soll bewahrt und überschritten werden, ja, sie wird eben nur bewahrt, wenn sie auch überschritten wird, ohne verletzt oder gar vernichtet zu werden. Diese Grenze ist das Fundament der Würde eines jeden Menschen. Dieses Fundament muss gefunden werden in jeder Begegnung. Auch dann, oder gerade dann, wenn die Sehnsucht nach dem Anderen übermächtig wird und alle Türen einzurennen droht, oder wenn wir in der unruhigen und flüchtigen Bewegung von einem Ort zum anderen, von einem Mensch zum anderen hetzen, weil wir suchen, ohne finden zu wollen, und fragen, ohne auf die Antwort zu hören. Martin Heidegger spricht davon, dass die menschlichste Haltung diejenige einer heiteren Gelassenheit und Offenständigkeit ist. Heitere Gelassenheit und Offenständigkeit sind in ihrem Wesen aber voneinander verschieden und grenzen sich, um sich selbst zu sein, jeweils voneinander ab. Indem sie diese Grenze wahren, berühren und ergänzen sie einander. Zum Beispiel: Jede Frage stört die heitere Gelassenheit, die in der heimatlichen Wohnstube ruht und sich wohl fühlt. Die Frage aber ist ein Gast, der kommt, um die Welt ins Haus zu tragen; sie ist der Weg, der Freude oder Sorge mit sich bringt. Die heitere Gelassenheit, die offenständig ist, nimmt die Frage gastfreundlich auf, weil sie weiss, dass die Heimat erst Heimat ist, wenn ein Weg zum Hause führt und Gäste empfangen werden. Jede Antwort aber stört die Offenständigkeit, die doch alle Türen öffnen will. Doch die Antwort ist auch ein Stück Heimat, ist ein Stück Zusammenhang, der Ruhe schenkt. Die Offenständigkeit wird durch die Antwort ein Stück heiterer und gelassener, weil sie weiss, dass der Weg nur Weg sein kann, wenn auf ihn eine Heimat, ein Geheimnis wartet, das ihn aufnimmt und erfüllt.
5 Die Wege zur Heimat führen an die Grenze hin. Die Grenzen möchten wieder deutlich werden, denn sie sind die Diener des Menschen. Die Grenzen möchten wieder deutlich werden, weil dadurch der Mensch wieder deutlich wird, sein Grenzesein, aber auch sein Grenzehaben. Die Grenzen rufen schon aus ihrer Stille in den Lärm hinein, um vom Lärm her laut zu sein, lauter, als sie sonst in ihrem Wesen wären. Und die Grenzen rufen auch schon aus ihrem Schmerz in die Angst hinein, um von der Angst her zu erschrecken, erschreckender zu sein, als sie sonst in ihrem Wesen sind. Lauter und erschreckender ruft und poltert der Weg an die Tür der Heimat, und lauter und erschreckender antwortet auch sie. Sie sind hilflos, Weg und Heimat, denn sie sind im Menschen. Vom Menschen her, von seinem Mut und seiner Demut her dürfen sie wieder Weg und Heimat sein und leiser werden, beide. Stille dürfte wieder Stille sein und Schmerz einfach Schmerz. Und weil sie den Menschen nicht mehr bedrohen müssten als Lärm und Angst, entstünden aus ihnen die neuen Grenzen für die Heimat und den Weg. Es wären neue Grenzen, denn früher, als die Welt noch gross und heil war und Himmel und Erde in ihr versöhnt, war sie eben doch nicht heiler und versöhnter, war sie weder kleinherziger noch grossartiger. Wir müssen die Grenzen nicht im Vergangenen finden, in den festen Werten der "alten und guten" Welt; wir müssen die Grenzen aber auch nicht neu erschaffen, als hätte es Grenzen noch nie gegeben. Mit ein bisschen Mut und Demut könnten wir den Ort der Stille und des Schmerzes wiederfinden, könnten uns zu all den Menschen setzen, die dort waren und noch immer sind, und nicht im Diskutieren und im Händeringen, sondern eben aus der Stille und dem Schmerz würden neue Grenzen wachsen, die uns Heimat sind und Weg.
|
|||
| Links | | Dokumente | Entstehung | Titelseite | Schlussbild | Bestellung | | Hauptindex | Homepage | Fragen | |
|||
|
Copyright: Steintisch Verlag Zürich 1998 |
X | ||
x |
|
x |
||